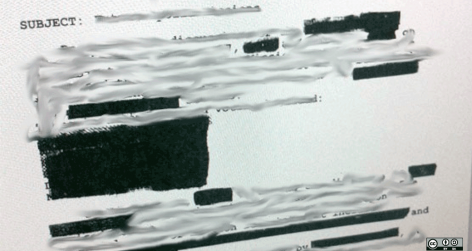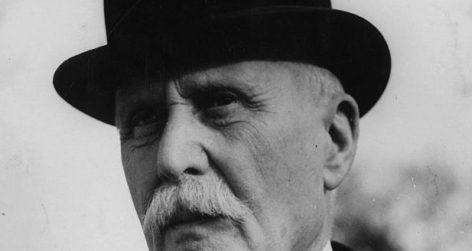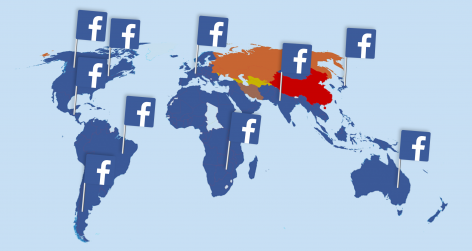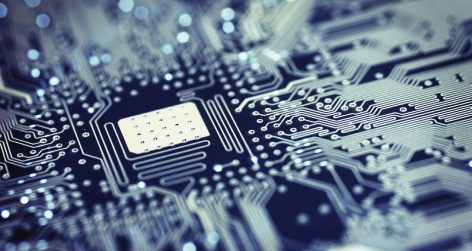Sarah Glatte untersucht die Kontroverse über Triggerwarnungen und erörtert, ob sie die Meinungsfreiheit fördern oder einschränken.

Angstzustände, Alpträume und körperliches Unwohlsein – Dies alles gehört zu den Symptomen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (kurz PTBS). Bei Frauen gehört die Erfahrung sexueller Gewalt zu den häufigsten Ursachen von PTBS, schon die Erinnerung an den Vorfall kann bei den Betroffenen traumatische Flashbacks auslösen. Deshalb sollen so genannte Triggerwarnungen (aus dem Englischen to trigger– etwas auslösen) in den Überschriften oder in den einleitenden Absätzen eines Artikels auf Inhalte oder Bilder hinweisen, die traumatische Szenen beinhalten. Triggerwarnungen tauchten zuerst in den Internetforen zur Unterstützung von Opfern sexueller Gewalt sowie in feministischen Blogs auf. In diesen Zusammenhängen sollen sie den uneingeschränkten Austausch von Gedanken und Erfahrungen sowie den freien Meinungsaustausch zwischen Opfern sexueller Gewalt und anderen Patienten der PTBS ermöglichen. So gesehen erscheinen Triggerwarnungen zunächst wie ein harmloses Mittel, um Leser vor verstörenden Inhalten zu bewahren.
Dennoch löste das Thema im Jahr 2014 eine Kontroverse in der US-amerikanischen Öffentlichkeit aus, da manche in Triggerwarnungen eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sahen. Im ganzen Land hatten sich studentische Gruppen dafür eingesetzt die Lehrpläne von Literaturseminaren und –Vorlesungen mit Triggerwarnungen zu versehen. Bald berichteten auch so einflussreiche Zeitungen wie die New York Times und The New Yorker über die Frage. Neben der flächendeckenden Einführung von Triggerwarnungen forderten die Studenten, das Konzept der Triggerwarnung zu erweitern. So bezieht sich der Begriff meist auf Themen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt oder Missbrauch. Manche Studenten (wie etwa am Oberlin College in Ohio) forderten jedoch Triggerwarnungen auch auf alle anderen Themen auszusprechen, die mit „Privilegien und Unterdrückung“ zu tun haben, das heißt etwa mit „Rassismus, Chauvinismus, die Diskriminierung von Homo-, Bi- oder Transsexuellen oder von Menschen mit Behinderung, Kolonialismus, religiöser Verfolgung“ und so weiter.
Verfechter der Meinungsfreiheit haben diese Diskussion mit Sorge beobachtet. Sie argumentieren, dass der pauschale Einsatz von Triggerwarnungen dazu führen könnte, dass manche Menschen bestimmten Themen kategorisch aus dem Weg gehen und sich damit, sei es im Internet oder in der Universität, anderen Meinungen komplett verschließen. Inwiefern solche Befürchtungen gerechtfertigt sind bleibt offen. Befürworter von Triggerwarnungen vergleichen diese mit Lebensmittelkennzeichnungen oder mit den Altersempfehlungen für Filme. Sie sollen den Lesern dabei helfen einzuschätzen, ob der Inhalt eines Textes für sie angemessen ist oder nicht. Ein positiver Nebeneffekt der aktuellen Diskussion besteht übrigens darin, dass marginalisierte Gruppen und Opfer sexueller Gewalt in der Öffentlichkeit an Sichtbarkeit gewonnen haben. Ein Grundsatz unseres Projektes, der Free Speech Debate, unterstreicht, dass sich die Fähigkeit des Einzelnen sein Recht auf freie Meinungsäußerung zu genießen nicht von seinem gesellschaftlichen Status trennen lässt. So gesehen kann das Streben der betroffenen Gruppen nach größerer Anerkennung und Empathie der Meinungsfreiheit schlussendlich nur förderlich sein.
Dagegen argumentiert Jenny Jarvie in New Republic: „Die Auseinandersetzung mit kritischer Argumentation ist für den Leser immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Wenn man Diskussionen mit Warnungen versieht, dann untergräbt man damit nur das Prinzip der intellektuellen Entfaltung.“ Hinzu kommt, dass Triggerwarnungen denjenigen dienen sollen, die in unserer Gesellschaft besonderen Schutzes bedürfen. Sie könnten jedoch zu einem „Wettrüsten“ verschiedener Interessengruppen führen, die der Meinung sind, dass ihre „spezifischen, politisierten Sensibilitäten“ als potentielle Auslöser traumatischen Stresses anerkannt werden sollten. Aus medizinischer Sicht ist die Liste der Wörter, Bilder oder selbst Gerüche und Geräusche sowie der Ereignisse, die PTBS auslösen können, lang. Ein Kommentator bemerkte: „Wo soll das hinführen, wenn wir erst mal anfangen, Warnungen für Inhalte mit möglichen traumatischen Folgen verpflichtend zu machen? (…) Da es keine objektive Definition der „möglichen Schäden“ gibt, existiert auch für solche Warnhinweise keine rationale Grundlage.“
Was ich an der aktuellen Debatte bedenklich finde, sind weniger die Vorschläge, eine größere Anzahl von Schlüsselwörtern als mögliche Trigger anzuerkennen, als die Forderungen Triggerwarnungen für bestimmte Themen verpflichtend zu machen. Ein Autor mag sich entschließen eine Triggerwarnung zu verfassen, um einzelne Leser vor schädlichen Erfahrungen zu schützen. Es ist jedoch eine ganz andere Sache, wenn wir Autoren dazu zwingen, vor allem da es weder wissenschaftliche Belege für den Nutzen von Triggerwarnungen noch objektive Methoden für die Bewertung verschiedener Trigger gibt. Wir haben weder das Recht beleidigt zu sein noch das Recht mit verstörenden Inhalten konfrontiert zu werden. Im informellen Rahmen können Triggerwarnungen sicherlich ein nützliches Mittel für Internetforen oder „designierte therapeutische Räume“ sein. In der Öffentlichkeit jedoch wiegt die Gefahr einer Einschränkung der Meinungsfreiheit durch verpflichtende Triggerwarnungen die Vorteile einer gesetzlichen Regelung bei weitem auf.
Sarah Glatte ist Mitherausgeberin der Free Speech Debate.